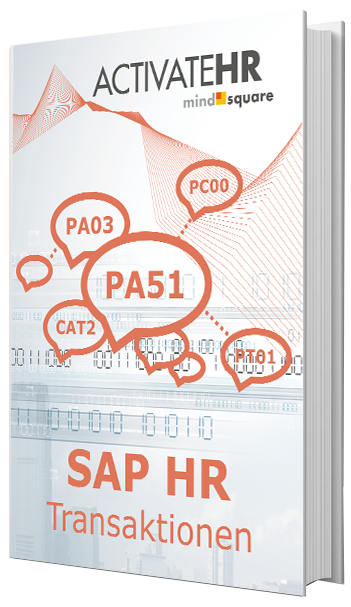Mehr und mehr fühle ich mich als Angehöriger einer aussterbenden Rasse. Das was sich einmal selbstbewusst als Bürgertum verstanden hat, scheint mir, zerfließt. Zwischen Individualismus, Hedonismus, Opportunismus und vor allem Gleichgültigkeit. Trägheit. Eine Todsünde, unter die man zu Zeiten der Festlegung solcher Hauptlaster auch vieles, was man heute als Depressionen oder Burn-out pflegt, subsumiert hätte. – Eine Gesellschaftszerlegung.
Der Bürger als angewandter Begriff beschränkt sich heute auf die Wirtshaus-Reklame für Hausmannskost und auf ideenlose politische Reden, die resümierend gerne auf den Willen der Bürger verweisen, der wahlweise angenommen wird oder zu erfragen wäre. Das letztere hohle Floskeln, das erste ein schwacher Nachhall des ursprünglichen Verständnisses. Steht doch die bürgerliche Küche für schnörkellosen Nährwert und dass man, mit Augenmerk auf Qualität, auch aus einfachen Zutaten Schmackhaftes zubereiten kann. Da schwingen Mäßigung, Rationalität und Fleiß mit. Aber auch eine Lebenslust der Zufriedenheit.
Wenn jedoch der Literaturchef der ZEIT, Ijoma Mangold, in seiner Rezension von Michael Kleebergs Vaterjahre meint, das sei ein materialistischer Roman, der mit großem psychologischem Raffinement davon erzählt, wie Beruf, Status, Geld, Hobbys, Ehepolitik und eine robuste Unempfänglichkeit für höhere Sinnfragen das konstruieren, was ein gelingendes bürgerliches Leben ausmacht, dann offenbart er seine ehrabschneidende Vorstellung vom Bürger als mittelständischen Spießer. Solches bürgerlich wird dann auch gern mit arriviert kombiniert, wörtlich angekommen. Da schwingt der Emporkömmling genauso mit wie die Annahme einer Erstarrtheit, was die Fähigkeit der weiteren Entwicklung betrifft. Mangolds Bürgerbegriff ist herrschender Zeitgeist, er taugt allenfalls als Ausdruck des intellektuellen Herabsehens.
Ebenso verhält es sich, wenn ein wenig kaschiert vom Kleinbürger gesprochen wird – Sklaven der Konsumwirtschaft, die um nichts so sehr Angst haben wie um ihr bisschen Besitz (das Auto, den Fernseher, die Couchgarnitur, das Abo im Fußballstadion), definiert der Schriftsteller Durs Grünbein. Im Kleinbürger reduziert sich der Mensch auf vulgären Opportunismus, weiß der Dichter, und wittert das Phänomen allerorts. Dass man die verkleinernde Vorsilbe auch gleich weglassen könnte, schwingt mindestens atmosphärisch, wenn nicht vorsätzlich mit. Über die Kleinbürgerschelte wird auch das Bürgersein in den Schmutz getreten.
Ansonsten ist der Begriff alles in allem marginal geworden. Die Bedeutung auch. Sich Bürger zu nennen, ist immer weniger die Klammer einer bestimmten Werteverbundenheit, geschweige denn, dass es noch für irgendjemand ein stolz getragenes Etikett wäre. Es ist verschwunden, ohne dass es durch einen anderen Titel ersetzt worden wäre. Nicht nur der Name schwindet, sondern auch die Idee.
Das wäre bloßes Lamento, würde nicht auf der Idee des Bürgertums die soziale Marktwirtschaft, wie sie Ludwig Erhard verstanden hat, gründen. Unser wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Erfolg der Nachkriegszeit ist ein bürgerlicher Verdienst. Es ist zu fragen, ob dieses Erfolgsmodell ohne seine maßgeblichen Träger Zukunft hat. Schaut man auf Staatsverschuldung, Sozialstaatsquote und Überregulierung, kann man ja durchaus so seine Zweifel haben.
Passend zum Erhardschen Ordoliberalismus hat Joachim Fest das Bürgertum einmal als Leben in geordneter Freiheit definiert. Und Peter Sloterdijk beschreibt in seinem Essay Der verletzte Stolz für den SPIEGEL die Entstehung des Bürgerselbstverständnisses im römischen Reich als Wandel vom teilnahmslosen Untertanen zum Aufständischen in ziviler Einmütigkeit wider die infame Ehrlosigkeit der herrschenden Kaste. Schon sind aus profundem Munde die staatstragenden Tugenden des Bürgertums zusammengebracht: Ordnung. Freiheit. Tatkraft. Gemeinsinn. Anstand.
Eben solche Bürger braucht das Land. Bekennend und anerkannt. Auf Ordnung bauend, also in Verantwortung für die Familie, für das Gemeinwesen und für die wirtschaftliche Unternehmung, die den Broterwerb sichert. Freiheitsliebend, um das Ausufern der Ordnung zu vermeiden, damit Kreativität und Schaffensfreude bewahrt bleiben. Tatkräftig, weil stets alles, was ist, geschaffen werden muss. Dem Gemeinwesen verbunden, da man sich der Kooperation als menschlichen Evolutionsvorsprung bewusst ist. Anständig, weil keine Ordnung dieser Welt je das selbständige moralische Reflektieren ersetzen kann.
Ordnung
Tatsächlich fehlt heute Bürgersinn an allen Ecken und Enden. Gehen wir die notwendigen Tugenden einmal der Reihe nach durch. Zuerst die Ordnung. Das, was wir heute Verantwortung nennen, hätte Immanuel Kant noch als Pflicht bezeichnet. Heute avanciert das Pflichtgefühl jedoch eher zum Schimpfwort. Überlegen Sie mal, wer heute noch bereit ist, sich im wahrsten Sinne des Wortes in die Pflicht nehmen zu lassen? Familie, Broterwerb und Gemeinwesen können aber nur gelingen, wenn sich alle, so gut sie es vermögen, dazu verpflichtet fühlen. Es gibt nämlich niemanden anderes, als uns selbst, der sich verbindlich darum kümmern könnte.
Die Realität sieht anders aus: Die Teilhabe an den öffentlichen Angelegenheiten, die Politik, wird allgemein nur noch mit Verdrossenheit in Verbindung gebracht. Die Mitglieder der Parteien schwinden, direktdemokratisches Engagement beschränkt sich auf ein paar uninformierte Klicks bei Online-Petitionen und die Beteiligung an den demokratischen Wahlen bricht dramatisch ein. Bei den letzten Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen, Sachsen und Hamburg lagen die Wahlbeteiligungen bei 47,9 und 52,7 und 49,1 und 56,9 Prozent. Bei den bayerischen Kommunalwahlen waren es durchschnittlich 55 Prozent; die spannende Nachfolge um den OB-Sessel in Deutschlands drittgrößter Stadt wollten bei der Stichwahl nur 38,5 Prozent der Münchner Wahlberechtigten mitbestimmen. Ein Großteil der noch sogenannten Staatsbürger verweigert dem Gemeinwesen die Souveränität.
Auch die Notwendigkeit des Lebensunterhalts bedingt kaum mehr Pflichtbewusstsein. Laut dem Gallup Engagement Index 2014 leisten 84 Prozent aller Arbeitnehmer höchstens Dienst nach Vorschrift, wenn sie nicht gar bereits innerlich gekündigt haben. Bei zugleich global und historisch niedrigsten Jahresarbeitsstunden und höchsten Urlaubszeiten stelle ich mir Verantwortungsbewusstsein im Erwerbsleben anders vor.
Schließlich das Familienleben. Gerade beim Kinder-Haben wird das natürliche Prinzip des Verpflichtetseins besonders anschaulich: Ohne dass Eltern Kinder bekommen und damit die Verpflichtung des Großziehens – letztlich eine lebenslange Verantwortlichkeit – eingehen, gibt es einfach keine Kinder. Ohne dass sich unsere Eltern darauf eingelassen hätten, gäbe es uns heute nicht. Der simple Schluss ist, dass es ohne elterliche Verantwortungsbereitschaft schlicht keine Gesellschaft gibt. Das ist in der Tat mehr und mehr zu befürchten. Mehr als jeder dritte Haushalt in Deutschland ist ein Single-Haushalt, ein weiteres Drittel sind Zwei-Personen-Haushalte. Jede fünfte Frau über 40 Jahre ist kinderlos, je Frau kommen nur 1,4 Kinder zur Welt. Zugleich sind die Abtreibungen auf konstant erschreckend hohem Niveau: Rund 200.000 Schwangerschaftsabbrüche werden es wohl Jahr für Jahr sein, ohne dass eine medizinische oder kriminologische Indikation vorliegt.
Freiheit
Den Niedergang der Freiheit als ausdrücklich erstrebenswertes Ideal spürt man allerorts beziehungsweise man erfährt umgekehrt die wachsende Bedeutungslosigkeit. Argumentiert man etwa für die Europäische Union mit Frieden und Freiheit, findet sich heute stets jemand, der abwinkt und solche alten Kamellen als wenig ausreichende Begründungen abtut.
Im genauso offenen wie unbegründeten Widerspruch dazu grassiert der Pazifismus. Die vorsichtige Einmischung etwa von EU, G7 und NATO gegen die Annexion der Krim und gegen die separatistischen Bewegungen in der Ukraine wird massenhaft als Kriegstreiberei gegen vorgeblich verstehbare russische Interessen verschrien. Der breite Konsens der Medien pro libertate gerät dabei zur Verschwörungstheorie eines westlichen Imperialismus.
Einer Mehrheit ist es offenbar inzwischen eher suspekt, dass es noch Menschen in diesem Land gibt, die schlicht nicht zusehen wollen, wie das Streben der Ukrainer nach Freiheit und deren Aufbegehren gegen die post-sowjetische Diktatur beistandslos bleibt. Freiheit wird mehr und mehr zur Rosinenpickerei. Die Wohlfahrtseffekte von Demokratie und sozialer Marktwirtschaft sind Selbstverständlichkeit, für die niemand mehr Mühe aufwenden will. Ganz zu schweigen davon, dass man auswärtig dafür irgendetwas riskieren wollte. Doch wer mag – selbst wenn er sich dem Westen und seinen Werten innigst verbunden fühlt – noch uneingeschränkt eine Lanze für ebendies brechen, wenn auch er sieht, dass wir dabei sind, die kühne, grandiose Idee der Freiheit zur Lizenz zum Raffen und gleichzeitigen Bräsigwerden verkommen zu lassen?, fragt die Schriftstellerin Thea Dorn jüngst in diesem Zusammenhang pessimistisch.
Entsprechend nichtig ist die reale Freisinnigkeit im Kleinen, im Alltäglichen. Die Menschen verlangen nach einem Wohlfahrtsstaat, nicht nach einem Freiheitsstaat. Für die möglichst allumfassende staatliche Fürsorge geben sie jegliche Selbstbestimmung auf. War Ludwig Erhards Bild des Staatsbürgers noch geprägt vom Vorrang der selbständigen, eigenverantwortlichen Lebensführung, zu die der Staat befähigen soll, hat sich das heute genau umgekehrt. Der Staat will heute allen erdenklichen Lebensunbill vorauseilend regulieren. Ein Teufelskreis, denn zunehmende Bemutterung führt doch stets zu schwindendem Verantwortungsbewusstsein. Wie soll es auch anders sein. Warum soll ich mich um etwas kümmern, worum sich doch längst jemand gekümmert hat. Das tragische daran ist die damit verbundene schwindende Fähigkeit, sich überhaupt noch selbst kümmern zu können.
Beispielhaft sei hier der gewichtige Einzug der Prävention in das öffentliche Gesundheitswesen genannt. Neun Milliarden Euro geben öffentliche Stellen inzwischen für Gesundheitsvorsorge aus. Immanent verständlich, denn Vorbeugen ist nicht nur besser als Heilen, sondern spart auch Kosten an anderer Stelle. Per Saldo vermutlich eine sinnvolle Geschichte. Zugleich offenbart es aber die sich ausbreitende Konsummentalität, was die Gesundheit betrifft. Man erhält sich nicht mehr gesund, man lässt sich gesund erhalten. Gecoachtes Nordic-Walking-Gekaspere und dann parkt man in der Tiefgarage und fährt mit der Rolltreppe zur Sportabteilung hoch, um sich im Kaufhaus die unabdingbaren Stöcke dafür zu kaufen.
Ein ureigenstes individuelles Interesse, die Gesunderhaltung, wird als öffentliche Angelegenheit delegiert. Unweigerlich verbunden mit der Aufgabe von Selbstbestimmtheit. Wie das endet, lässt sich in Juli Zehs Dystopie Corpus Delicti nachlesen. So viel sei verraten: Alles andere als frei.
Tatkraft
Kommen wir zur Leistungsbereitschaft. Nichts entsteht von selbst, auch wenn es so manchem im gegebenen Umverteilungsstaat anders erscheinen mag. Das herrschende Unverständnis offenbart sich regelmäßigen in Verlautbarungen der sogenannten Wohlfahrtsverbände zum Lohnabstand, also dem angeblich notwendigen Unterschied zwischen niedrigen Einkommen und dem staatlichen Hartz-IV-Transfer. Nach der gängigen Auffassung dieser vom Gemeinwesen finanzierten Organisationen würde sich die Aufnahme einer Erwerbsarbeit nur dann lohnen, wenn damit netto mehr als die staatliche Sozialleistung verdient wird. Es wird dabei vollständig ausgeblendet, dass für die Verfügbarkeit von Sozialleistungen immer zu allererst einmal Arbeit notwendig war … allerdings von anderen!
Eigentlich bestünde geradezu diametral eine solidarische Verpflichtung, so viel wie möglich für das eigene Auskommen selbst zu leisten, allein deswegen, um nicht anderen seinen Unterhalt aufzuhalsen. Diese Selbstverständlichkeit von Geben und Nehmen, von Leistung und Gegenleistung ist im deutschen Wohlstandswohlfahrtsstaat vollends verloren gegangen.
Und diejenigen, die arbeiten, haben Stress. So viel Stress, dass die Arbeitsministerin allen Ernstes über ein Anti-Stress-Gesetz nachdenkt, um den allseits beschworenen Druck auf die Arbeitnehmer zwangsabzulassen. Völlig ausgeblendet dabei die historisch und global einmalig niedrige Erwerbsarbeitsbelastung genauso wie die einmalig viele Freizeit. Die durchschnittlich effektive Arbeitsleistung der Deutschen ist mit 1413 Stunden pro Jahr im OECD-Vergleich beinahe einzigartig niedrig (2011). 30 Tage bezahlten Urlaub gibt es durchschnittlich im Jahr. Dazu noch je nach Region bis zu 13 gesetzliche Feiertage; je nach Lage der Feiertage also zwischen sieben und neun Urlaubswochen im Jahr. Dazu kommen dann noch im Mittel rund 15 Tage Krankschreibungen per anno, die gerade zu Zeiten guter Konjunktur und Fachkräftemangel durchaus nicht immer auf wirkliches Leiden zurückzuführen sind.
Apropos Krankschreibungen: Gegen die 15 Tage Arbeitnehmerfehlzeiten stehen weniger als sieben Tage, die Unternehmer im Jahr nicht auf dem Posten sind. Der Hintergrund dieser scheinbar wundersamen Immunisierung der Selbständigen ist schnell gefunden: ihre Leistungsbereitschaft. Wer schafft, hat keine Zeit zum Krank-Sein.
Lassen Sie mich von den gleichzeitig boomenden Freizeitbeschäftigungen nur noch kurz eine zu diesem Thema herausgreifen. Die passivste. Das Fernsehen. Rund vier Stunden schauen die Deutschen durchschnittlich täglich fern. Nachdem allerdings rund ein Drittel der Bevölkerung sehr wenig oder gar nicht schaut, muss der Rest entsprechend mehr glotzen. Fünf, sechs, sieben Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr, ein Leben lang. Am Rande: Ich spreche nur vom Fernsehen, YouTuben und sonstiges Internet-Surfen und Computerspielen kommen gegebenenfalls noch extra dazu. Von einer Gesellschaft mit Tatendrang lässt sich da beileibe nicht mehr sprechen.
Solidarität
Diesen Tatendrang braucht eine Gesellschaft aber für ihr gedeihliches Fortbestehen. Nicht nur zum Broterwerb, sondern vor allem auch für den unerlässlichen Kit im Gemeinwesen: für das gegenseitige Einstehen. Aufgeklärten Egoismus hat der Verhaltensforscher Frans de Waal den menschlichen Evolutionsvorsprung genannt. Die Einsicht des Menschen in die Überlebenskraft des Gemeinwesens und die dementsprechend als notwendig erkannte Solidarität untereinander.
Verunstaltet wird die Solidarität aber heute zur pauschalen Forderung nach Gleichheit der Lebensverhältnisse. Der jakobinische Egalitarismus schwelt allerorts, nur dass man inzwischen wenigstens nicht mehr mit der Guillotine gleichgestutzt wird. Gleichheit ist aber per se unsolidarisch, denn wie soll es denn noch zu einem gesellschaftlichen Ausgleich kommen, wenn alle gleich sind. Der heilige Sankt Martin konnte seinen Mantel nur teilen, weil er sich vorher einen verdient hatte. Oder wie es Abraham Lincoln ausdrückte: Ihr werdet die Schwachen nicht stärken, wenn ihr die Starken schwächt. Wenn der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty dagegen heute wie ein Star umjubelt eine progressive Einkommenssteuer von bis zu 80 Prozent fordert, wird der andersgesinnte, sozialistisch durchwobene Zeitgeist offensichtlich.
Unabhängig vom wörtlichen Vermögen und unabhängig vom ebenfalls wörtlich gemeinten Verdienst und sogar unabhängig vom Bedarf will jeder möglichst gleichermaßen etwas vom Kuchen haben. Ginge es in der Bundesregierung nach Linken, Grünen und SPD würde sogar das in Unternehmen und Produktionsanlagen investierte Kapital in seiner Substanz besteuert. Das heißt gemindert. Das heißt weniger produktiv. Das heißt weniger Wohlstand für alle.
Einmal mehr hat Ludwig Erhard auch hier den bürgerlichen Gegenpol treffend auf den Punkt gebracht: Es stünde im sozialen Leben um manche Not in unserem Volke besser, wenn wir nicht zu viel sozialen Kollektivwillen, sondern mehr soziale Gesinnung und Haltung bezeugen wollten. Das eine aber schlägt das andere tot, und darum stellt sich uns zuletzt die Frage, ob wir, einig in dem Willen und der Verpflichtung, keinen deutschen Menschen mehr der Not ausgesetzt zu sehen, gut daran tun, die besten menschlichen Tugenden im perfektionierten Kollektivismus gar völlig zu ersticken oder ob wir nicht im Streben nach mehr Wohlstand und durch die Eröffnung immer besserer Chancen zur Gewinnung persönlichen Eigentums dem verderblichen Geist des Kollektivismus Todfehde ansagen sollten. Diese Frage stellen heute nur noch wenige.
Anstand
Die Solidarität wird heute vom viel weiter gefassten Streben nach sozialer Gerechtigkeit ersetzt. Sie bestimmt alle Präambeln der politischen Programme. Ohne dass jemand sagen kann, was das überhaupt heißen soll. Welche Gerechtigkeit ist sozial, also dem Gemeinwesen förderlich? Wie viel weniger Leistungsgerechtigkeit und mehr Leistungsfähigkeitsgerechtigkeit macht einen sozialen Staat aus? Wie fügen sich da Chancen- oder Generationengerechtigkeit ein? Wie viel oder wenig Freiheit ist dabei möglich beziehungsweise nötig? Fragen über Fragen, die alle auf ein und dieselbe Antwort zulaufen: Es ist ein ethischer Maßstab erforderlich. Erst in der Bewertung von gutem und schlechtem Handeln wird eine Gesellschaft zukunftsfähig. Was dem Gemeinwesen gerecht wird, lässt sich nur aus einer moralischen Auseinandersetzung ableiten. Das wäre dementsprechend auch das einzig sinnvolle Leitbild eines zukunftsträchtigen politischen Diskurses.
Aber die moralische Dimension von Gesellschaft geht noch viel tiefer. Während sich um manche Tugenden trefflich politisch streiten lässt, sind andere das Rückenmark des Gesellschaftskörpers. Dazu gehört das individuelle Bewusstsein, Teil eines Ganzen zu sein. Und eben das ist das bürgerliche Selbstverständnis. Der Bürger ist der Burgbewahrer, der Verteidiger des gemeinschaftlichen Zusammenschlusses.
In einem Gemeinwesen ist man nicht Mitglied, sondern Teilhaber. Jeder ist mitverantwortlich für das Wohl und Weh des Ganzen. Die Mindestanforderung an jeden Einzelnen ist dabei, sich an die gemeinsam ausgehandelten Regeln zu halten. Nicht, dass man nicht mal über eine rote Ampel gehen darf, sondern es geht um das Substanzielle. Die Mindestanforderung ist, dass man die gegebene Ordnung nicht gemeinschädlich bricht.
Das Gebot, die Ordnung nicht zu brechen, kann nie selbst Teil der Ordnung sein. Das kann nur moralische Einsicht gebieten. Die unerlässliche moralische Grundfeste eines Gemeinwesens ist also, gemeinschädliche Regelbrüche zu unterlassen. Dazu braucht es auch keiner moralischen Kontrollinstanz, denn eigentlich weiß ein jeder, wann er sich selbst den Teppich unter den Füßen wegzieht.
Steuerhinterzieher wie Uli Hoeneß, Alice Schwarzer und Patrick Lindner oder Steuerflüchtlinge wie Michael Schumacher, Boris Becker, Jan Ulrich und Theo Müller oder kreative Steuergestalter wie Carsten Maschmeyer und die Führungstagen von Amazon, Ikea und Co, und die unzähligen Namenlosen, die es denen im Großen wie im Kleinen nachmachen, zeigen eine andere Wirklichkeit. Sie alle erscheinen aus Bürgersicht weit mehr als straffällig. Sie sind anstandslos. Gemeingefährlich. Staatsfeindlich.
Wir wollen die Kirche im Dorf lassen. Wer ein, zwei Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte bei der Steuererklärung dazu erfindet, ist sicher kein Staatsfeind, wie wohl man bereits hier die Unmoral nicht leugnen kann. Aber spätestens wenn einer bildlich das Geld in den Koffer packt und außer Landes schafft, um es der allgemeinen Besteuerung zu entziehen, dann kündigt er bewusst und vorsätzlich seine Teilhaberschaft an der Gesellschaft auf. Bei geschätzten 13 Milliarden Steuerhinterziehung pro Jahr und Schwarzarbeit mit einem Volumen von je nach Schätzung bis zu 17 Prozent des Bruttoinlandsproduktes werden einem die herrschende Dimension solcher innerer Kündigungen bewusst.
Die moralische Grundregel, sich halbwegs an die Ordnung zu halten, ja viel mehr noch der Anstand, wenn es einem etwas besser als den anderen geht, sein Vermögen eher mehr als weniger in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen, verkommen massenhaft. Solche Unmoral ist auf Dauer nicht staatstragend.
Bürgerbewegung
Das Vorstehende wird vermutlich insbesondere zwei Reaktionsmuster auslösen. Zum einen werden all jene, die nicht Freiheit, Verantwortung, Leistung, Ungleichheit und Werte als die entscheidenden Dimensionen nachhaltigen Zusammenlebens verstehen, die Ausführungen in Bausch und Bogen ablehnen. Vermutlich mit dem als Schimpfwort gemeinten Kompliment, mich neoliberal zu nennen. Denen sei die Lektüre einer Biografie Ludwig Erhards ans Herz gelegt, zusammen mit dem Gedankenexperiment, wie wir wohl heute dastehen würden, wenn 1948 Erhards Opposition die Oberhand gewonnen hätte.
Zum anderen wird es einige geben, die sich ungerecht behandelt fühlen. Weil sie dem geschilderten Mainstream der grassierenden Untugenden tatsächlich widerstehen. Denen will ich zurufen: Bravo! Weiter so. Ihr schafft Zukunft. Und: Nennt euch Bürger und seid stolz darauf.
Keinen INSM-Blog-Post mehr verpassen? Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, Google+ oder abonnieren Sie unseren RSS-Feed oder Newsletter.